|
|
|
|
Der
Entwurf Talsperre
Caprice stellt die Projektierung,
die hydraulische
und die wasserwirtschaftliche Berechnung
des
Speichers für ein Wasserkraftwerk dar.
|
|
Die
an einer Engstelle
der Winneschlucht im Bereich unterhalb der
Schutzhütte "Panorama" zu errichtende
Sperre ist als Betongewichtsmauer mit einer
luftseitigen Neigung von 1:0,7 ausgeführt
worden. |
|
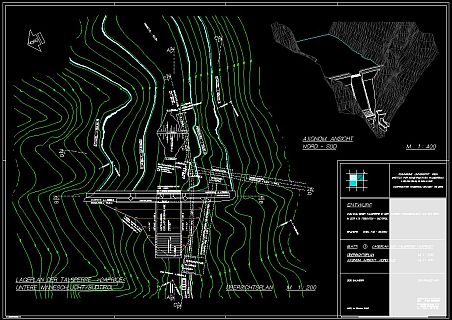
|  |
|
|
|
|



|
|
Unter Bedacht eines möglichen Lawineneinstoß -es in den Speicher, wurde der Sperrentyp gewählt und der Stauraum dimensioniert.
Geologie - Unter
Berücksichtigung, dass im Sperrenbereich
beide Seitenflanken des Talprofils laut
geologischem Gutachten mit ca. 2,40 m Bergschuttüberlagerung
überdeckt sind und darauffolgend rund 2,00-3,00
m stark verwitterter Fels (Carbonatgestein)
herrscht, kann mit guten Gründungsverhältnissen
gerechnet werden. Am Talboden stößt man
nach ca. 3,50 m Bergschuttüberlagerung und
1,50-2,00 m gelockertem Fels auf kompakten
Untergrund.
Durch diese geologischen
Verhältnisse wird bis auf den unverwitterten
Fels eine allseitige Einbindung der Mauer
vorgenommen.
Der,
durch die
Schwergewichtsmauer künstlich
geschaffene Stausee hat eine Länge von rund
3.300 m und verfügt über einen nutzbaren
Speicherinhalt von 14,91 hm³. Sein Stauziel
liegt auf Kote +1.134,00 m ü.d.M.; das Absenkziel
bei +1.116,00 m ü.d.M.
|
|



|
|
|
|
|
|
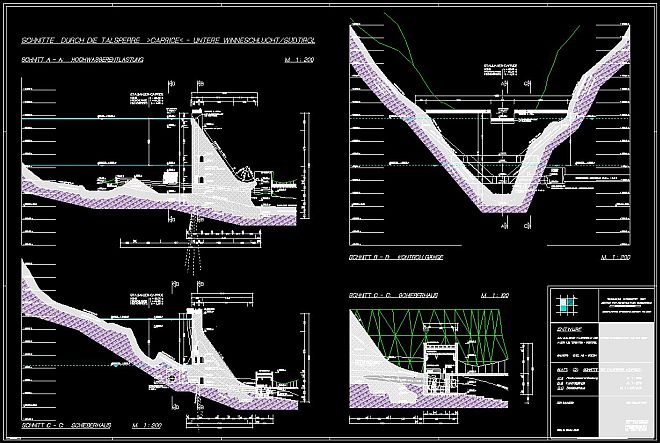
|
|
Folgende
Lastfälle wurden
für die Standsicherheitsberechnung der Staumauer
berücksichtigt:
Betriebslastfall:
Normal - Vollstau mit
Eisdruck
Betriebslastfall: Außergewöhnlich
- Überstau; RHHQ = 16 m³/s
Betriebslastfall:
Extrem - Überstau von 2,00 m bei Lawineneinstoß
Betriebslastfall: Erdbeben -
Eintrittswahrscheinlichkeit 200 J, max b
= 0,12 g
|
|

|
|
|
|
|
|
Die
maximale Höhe der
geplanten Sperre - von der Talsohle bis
zur Oberkante der Sperrenkrone - beträgt
36,00 m, die mittlere Kronenlänge quer zur
Talrichtung etwa 54,50 m und die maximale
Sperrenbreite längs der Talrichtung 24,55
m. Die Mauerkrone ist 4,00 m breit, ihr
Niveau liegt auf + 1.136,00 m ü.d.M. Die
Kubatur der Schwergewichtsmauer beträgt
rund 12.000 m³.
Dichtschirm
- Zur Abminderung des Sohlwasserdruckes
und zur Verhinderung von ungewollten Wasserumläufigkeiten,
ist ein Tiefeninjektionsschirm vorgesehen.
Kontrollgänge im inneren der Staumauer sind
so angelegt, dass bei Bedarf jederzeit nachinjiziert
werden kann. Dichten Felsanschluss an den
Sperrenbeton gewährleisten Kontaktinjektionen.
Kontrollgänge
-
Der Zugang zu den Kontrollgängen erfolgt
über den Verbindungsstollen vom Schieberhaus
zur Schieberkaverne. Sie dienen zur Kontrolle
verschiedenster Messeinrichtungen, sowie
zur eventueller Nachinjektion des Dichtschirmes.
Auf Grund dessen sind sie so angelegt, dass
eine leichte Injektionsbohrung in den Umgebungsgrund
ermöglicht wird.
Am
Beginn der Hochwasserentlastungsanlage
befindet sich ein festes, als WES-Profil
ausgebildetes, Überfallwehr mit einer Breite
von 9,00 m.
Die Wasser-Wurfweite der
Schanze - bei Hochwasser und beim gewählten
Endwinkel von 30° - beträgt 12,43 m.
Laut
geologischem Gutachten ist der Fels im Bereich
des natürlichen Tosbecken unterhalb des
Speichers derartig stabil, dass keinerlei
Auskleidung des Bachbettes erforderlich
ist.
Die geplante Hochwasserentlastungsanlage
ist für ein RHHQ von 16,00 m³/s - das entspricht
einem Überstau von 0,90 m - dimensioniert.
Während
der Bauzeit wird der Grundablass
gleichzeitig als Baustellenumleitung verwendet
und kann ein angenommenes Hochwasser von
8,00 m³/s aufnehmen.
Das Ablassrohr mündet
unterhalb der Zufahrtsstraße beim Schieberhaus
in das bestehende Bachbett. Die Energieumwandlung
übernimmt Größtteils der Kegelstrahlschieber
|
|
|
|






|
Übersicht der
Baudurchführung
Errichtung
der Baustellen-Zufahrtsstraße mit gleichzeitigem Abtrag
von Bergschuttmaterial bzw. von Fels für das Bauwasser-Umleitungsrohr.
Fertigstellung
der Bauwasserumleitung (Stahlrohr Æ 1,40 m, i = 7,167%,
offene Bauweise), die später als Grundablass dient.
Aufschüttung
des Fangedammes (Umleitung des Baches durch den späteren
Grundablass).
Beginn:
Bergmännischer Vortrieb des Verbindungsstollen; maschineller
Vortrieb mit gleichzeitiger Auskleidung des Triebwasserweges
(Druckstollen, Ausbruch der Schieberkaverne, Erstellung
des Wasserschlosses, Druckschacht).
Abtrag
des Bergschuttes und des Gesteins bis auf den unverwitterten
Fels im Bereich der Staumauerkontaktflächen.
Beginn
der Injektionen für den Dichtschirm.
Errichtung
der Talsperre inklusive Kontrollgänge in den entsprechenden
Betonierabschnitten.
Fertigstellung
der Hochwasserentlastungsanlage.
Herstellung
des Triebwasser-Einlaufbauwerkes.
Erstellung
des Schieberhauses.
Einbau
sämtlicher Betriebseinrichtungen (Portalkräne, Drosselklappen
in der Schieberkaverne und beim Wasserschloss, Kegelstrahlschieber
und Drosselklappe im Schieberhaus, Steueranlagen, Kontrolluhren,
Batterieanlage u.ä.).
Nach-
und Feinarbeiten.
Der geplante Fertigstellungstermin
des Kraftwerkes in Kiens fällt mit dem der Talsperre,
inklusive aller Betriebseinrichtungen, zusammen.
|
